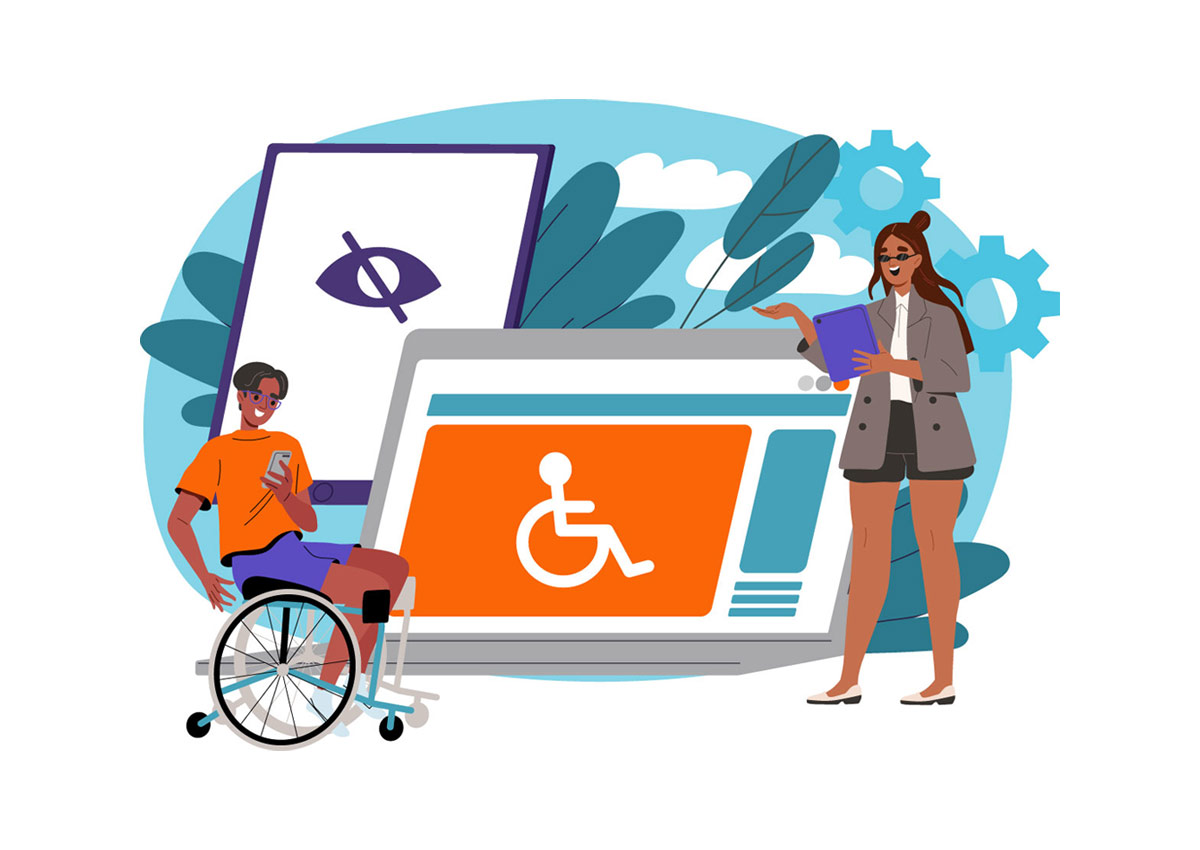Weitere Pflichten und Gesetze:

Widerrufsbutton im Onlineshop: Was Händler bis Juni 2026 wissen und umsetzen müssen
Mit dem „Widerrufsbutton“ kommt ab 19. Juni 2026 eine neue gesetzliche Pflicht für alle, die online an Verbraucher verkaufen. Ziel ist es, den Widerruf von Online-Käufen so einfach zu machen wie den Kauf selbst – per Klick statt per E-Mail oder Brief. Verbraucher sollen Verträge künftig unkompliziert online widerrufen können, ohne lange suchen zu müssen.
Für den Onlinehandel bedeutet das zwar zunächst technischen und rechtlichen Anpassungsbedarf, langfristig aber auch Vorteile: Ein klar strukturierter Widerrufsprozess sorgt für mehr Transparenz, weniger Rückfragen und höhere Kundenzufriedenheit. Wer den Button frühzeitig integriert, stärkt das Vertrauen in seinen Shop und zeigt, dass er Verbraucherrechte ernst nimmt.
Dieser Leitfaden erklärt, was der neue Widerrufsbutton im Onlineshop konkret bedeutet, welche rechtlichen Vorgaben gelten, wie die Umsetzung technisch gelingt – und warum die Neuerung nicht nur Pflicht, sondern auch Chance ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Rechtlicher Hintergrund
Was genau ist der Widerrufsbutton und warum wird er eingeführt?
Der Widerrufsbutton ist eine gesetzlich vorgeschriebene elektronische Widerrufsfunktion im Onlineshop. Ziel: Der Widerruf soll so einfach werden wie der Kauf – mit wenigen Klicks. Grundlage ist die EU-Richtlinie 2023/2673, die europaweit eine „funktionierende und leicht zugängliche“ Online-Widerrufsmöglichkeit verlangt. Der Button ergänzt bestehende Wege (E-Mail/Brief) – er ersetzt sie nicht.
Welche Verträge sind betroffen?
Alle Fernabsatzverträge über Waren, Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen, die über eine Online-Benutzeroberfläche (Website, App) geschlossen werden. Telefon-/E-Mail-/stationäre Verträge sind nicht umfasst. Auch digitale Inhalte/Dienste (z. B. E-Books, Online-Kurse) fallen darunter, sofern ein Widerrufsrecht besteht. Erlischt das Widerrufsrecht wirksam (z. B. bei vorzeitigem Erlöschen nach Einwilligung), lebt es durch die bloße Button-Anzeige nicht wieder auf.
Gibt es Ausnahmen?
Ja – überall dort, wo kein gesetzliches Widerrufsrecht besteht (z. B. nach Kundenspezifikation gefertigte Waren, leicht verderbliche Ware, entsiegelte Hygieneartikel, entsiegelte Ton-/Video/Software, termingebundene Freizeitaktivitäten wie Tickets). B2B-Verträge ohne Verbraucherbeteiligung sind nicht umfasst.
Gilt die Pflicht auch für Kleinunternehmer?
Wie beim neuen KI-Gesetz gilt die Regelung unabhängig von der Größe der Unternehmens – maßgeblich ist, dass an Verbraucher online verkauft wird.
Gemischtes Sortiment (widerrufsfähig und nicht widerrufsfähig)?
Auch wenn im Shop sowohl Produkte mit als auch ohne Widerrufsrecht angeboten werden, muss der Widerrufsbutton bereitgestellt werden. Nur wenn alle angebotenen Artikel eindeutig vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind – was in der Praxis selten vorkommt – entfällt die Pflicht. Die Einschätzung, ob für ein bestimmtes Produkt ein Widerrufsrecht besteht, liegt in der Verantwortung des Unternehmens.
Gilt das auch auf Marktplätzen (Amazon, eBay)?
Ja – die Pflicht besteht grundsätzlich. Technisch ist in der Regel der Marktplatzbetreiber zuständig -der Händler bleibt aber rechtlich involviert (siehe Haftung unten).
2. Technische Umsetzung
Wie muss der Widerrufsbutton gestaltet sein?
- Prominent, leicht zugänglich, gut lesbar und klar abgehoben vom restlichen Design.
- In Footer-Bereichen sind Kontrast, Größe und Abgrenzung besonders wichtig (keine Verwechslung mit Impressum/AGB).
- Eindeutiger Text, z. B. „Vertrag widerrufen“. Mehrdeutige Begriffe wie „Stornieren“ oder „Serviceanfrage“ vermeiden.
Muss es ein „Button“ sein?
Erforderlich ist eine Widerrufsfunktion. Ein klar erkennbarer, prominenter Link kann genügen – entscheidend ist Eindeutigkeit und Auffindbarkeit.
Wie läuft der Prozess nach dem Klick? (2-Stufen-Verfahren)
- Klick auf „Vertrag widerrufen“ → Weiterleitung auf separate Seite mit Widerrufsformular.
- Absenden über Bestätigungsbutton mit eindeutiger Beschriftung, z. B. „Widerruf bestätigen“.
Welche Daten dürfen/müssen abgefragt werden?
- Nur das Notwendige zur eindeutigen Zuordnung:
- Name des Verbrauchers,
- Vertrags-/Bestellkennung (z. B. Bestell-, Auftrags-, Vertragsnummer),
- Kommunikationskanal für die Eingangsbestätigung (i. d. R. E-Mail).
- Optional kann ein Widerrufsgrund abgefragt werden – nicht verpflichtend.
Was passiert nach Absenden?
Sobald der Widerruf abgesendet wurde, muss der Shop-Betreiber unverzüglich eine Eingangsbestätigung auf einem dauerhaften Datenträger – in der Regel per E-Mail – versenden. Diese Bestätigung sollte den Inhalt des Widerrufs sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs enthalten. Wichtig ist, auf Formulierungen zu verzichten, die bereits eine inhaltliche Prüfung suggerieren („Ihr Widerruf wurde bestätigt“). Besser ist eine neutrale Formulierung wie: „Ihr Widerruf ist bei uns eingegangen, wir prüfen ihn umgehend.“
Nach einem wirksamen Widerruf beginnt die Rückabwicklung. Der Kaufpreis muss innerhalb der gesetzlichen Frist erstattet werden. Bei Warenlieferungen darf die Rückzahlung allerdings so lange zurückgehalten werden, bis die Ware wieder eingegangen ist oder der Nachweis über die Rücksendung vorliegt.
Teilwiderruf
Ein Teilwiderruf ist gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehen, kann aber freiwillig angeboten werden. Entscheidet sich ein Shop dafür, sollte die technische Umsetzung es ermöglichen, einzelne Artikel aus einer Bestellung – etwa über eine Bestellübersicht – auszuwählen. Dabei ist zu beachten, dass Teilwiderrufe die Rückabwicklung komplizierter machen können, beispielsweise im Hinblick auf anteilige Versandkosten oder gewährte Preisnachlässe.

3. Durchgehende Verfügbarkeit
„Während der gesamten Widerrufsfrist“ bedeutet praktisch: Da die 14-Tage-Frist individuell mit dem Warenerhalt startet, wäre ein kundenindividuelles Ein- oder Ausblenden des Widerrufsbuttons technisch sehr aufwendig. Eine praktikable und zulässige Lösung ist daher, den Widerrufsbutton pauschal dauerhaft anzuzeigen – also ohne kundenspezifische Steuerung. Dass dies als „verlängertes Widerrufsrecht“ missverstanden werden könnte, wird zwar diskutiert; dem spricht jedoch entgegen, dass die Widerrufsfrist gesondert kommuniziert wird und die bloße Sichtbarkeit der Funktion nicht erklärt, dass im Einzelfall ein Widerrufsrecht (weiterhin) besteht.
Empfehlenswert ist daher ein klarer Hinweis im Prozess und in der Eingangsbestätigung, der die gesetzlichen Fristen explizit benennt.
4. Rechtliche Fallstricke – Learnings vom Kündigungsbutton
Die Rechtsprechung zum Kündigungsbutton ist auch für den Widerrufsbutton relevant, da viele Grundprinzipien direkt übertragbar sind. Dazu gehören die leichte Auffindbarkeit, das Vermeiden unnötiger Hürden und eine klare, eindeutige Beschriftung. Eine Login-Pflicht ist nur dann zulässig, wenn auch der Vertragsschluss selbst ausschließlich mit einem Kundenkonto möglich war.
In allen anderen Fällen muss der Widerrufsbutton ohne vorherigen Login zugänglich sein. Ebenso unzulässig ist es, die Funktion in einer Linkliste zu verstecken – sie muss stets unmittelbar, gut sichtbar und eindeutig platziert sein.
5. Rechtsfolgen bei Verstößen
- Bußgelder: Bis 4 % des Jahresumsatzes (> 1,25 Mio. € Umsatz), sonst bis 50.000 €.
- Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen: Bei fehlerhafter Platzierung/Beschriftung, fehlendem 2-Stufen-Ablauf, versteckten Funktionen oder veralteten Rechtstexten.
- Marktplätze: Technisch meist der Betreiber in der Pflicht. Händler bleiben jedoch adressiert und sollten Regress prüfen, wenn der Betreiber mangelhaft umsetzt.
6. So bereiten Sie sich vor
Diese ToDo’s können Sie bereits jetzt umsetzen:
- Bestandsaufnahme: Welche Angebote sind widerrufsfähig? Wo gibt es Ausnahmen?
- UX-Konzept: Position (Header/Sticky/Deeplink in Konto UND öffentlich), Wording, 2-Stufen-Flow, E-Mail-Templates.
- Datenmodell: Felder für Name, Bestellkennung, Kontaktkanal; optional Grund (als freiwilliges Feld).
- Rechtstexte entwerfen (noch nicht live): Widerrufsbelehrung inkl. Hinweis auf „Bestehen und Platzierung der Widerrufsfunktion“; Datenschutzerklärung (Datenarten, Zwecke, Speicherdauer).
- Marktplätze: Status klären, Verantwortlichkeiten dokumentieren.
Umsetzung (nach Verabschiedung des nationalen Gesetzes)
- Development starten (Button, Formular, Bestätigungsseite, Mails, Logging).
- QA/Legal-Review: Beschriftung, Sichtbarkeit, Barrierefreiheit (Kontrast, Tastatursteuerung, Screenreader-Labels).
- Go-Live-Checkliste prüfen
- Timing: Mit der Technik starten, sobald das endgültige nationale Gesetz vorliegt. Deadline für Live-Betrieb: 19.06.2026.
Rechtstexte anpassen
- Widerrufsbelehrung: um Hinweis auf Widerrufsfunktion erweitern (zum richtigen Zeitpunkt).
- Datenschutzerklärung: Erhobene Pflichtdaten + Speicherfristen dokumentieren (DSGVO-Datensparsamkeit).
Fazit und gut zu wissen
Der neue Widerrufsbutton bringt ab dem 19. Juni 2026 eine klare gesetzliche Pflicht für alle Online-Händler mit sich, die Verträge über eine digitale Benutzeroberfläche mit Verbrauchern schließen. Die dauerhafte Anzeige der Widerrufsfunktion ist rechtlich zulässig und technisch der einfachste Weg, um die Vorgaben zu erfüllen. Wichtig ist, im Prozess deutlich auf die gesetzliche 14-tägige Widerrufsfrist ab Erhalt der Ware hinzuweisen, um Missverständnisse zu vermeiden. Wer sich frühzeitig mit der technischen Umsetzung, der Anpassung der Rechtstexte und der Benutzerführung befasst, kann die neuen Anforderungen stressfrei erfüllen – und zugleich das Vertrauen seiner Kunden stärken.
Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine Rechtsberatung. Für verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihre Rechtsabteilung oder Fachkanzlei.
KI wurde zur Unterstützung bei der Erstellung von Texten und Bildern eingesetzt.
array(8) {
["@type"]=>
string(11) "NewsArticle"
["identifier"]=>
string(17) "#/schema/news/531"
["headline"]=>
string(85) "Widerrufsbutton im Onlineshop: Was Händler bis Juni 2026 wissen und umsetzen müssen"
["datePublished"]=>
string(25) "2025-10-20T08:19:00+02:00"
["url"]=>
string(50) "/aktuelles/widerrufsbutton-pflicht-onlineshop-2026"
["description"]=>
string(160) "Ab Juni 2026 wird der Widerrufsbutton EU-weit Pflicht im Onlinehandel Pflicht. Handeln Sie frühzeitig und machen Sie sich mit den neuen Anforderungen vertraut."
["author"]=>
array(2) {
["@type"]=>
string(6) "Person"
["name"]=>
string(13) "Steffi Greuel"
}
["image"]=>
array(6) {
["@type"]=>
string(11) "ImageObject"
["caption"]=>
string(0) ""
["contentUrl"]=>
string(57) "/assets/images/9/widerrufsbutton-2026-td2rreahd1rzww5.jpg"
["identifier"]=>
string(51) "#/schema/image/ddc216f0-ad7c-11f0-b45d-4ba2fe2895fe"
["license"]=>
string(0) ""
["name"]=>
string(0) ""
}
}